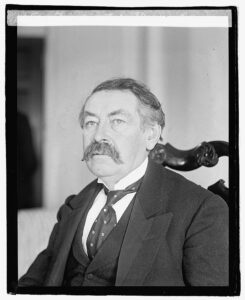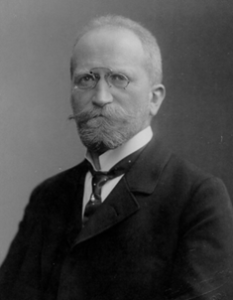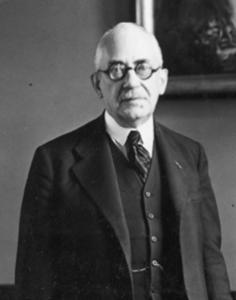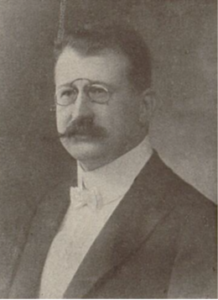Weitere bedeutende Persönlichkeiten, die (neben Dr. Elemér Hantos) einen wichtigen Beitrag zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit weltweit geleistet haben:
Pál Auer (1885–1978), ungarischer Anwalt, Politiker und Diplomat.
Nach seinem Jurastudium an der Universität Budapest und Aufenthalten in Wien, Berlin, Paris und London legte Pál Auer 1911 erfolgreich die Anwaltsprüfung ab. Anschließend eröffnete er eine Kanzlei in Budapest und spezialisierte sich auf Völkerrecht. Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns am Ende des Ersten Weltkriegs war Pál Auer Mitglied des Nationalrats unter Mihály Károly. Nach einer Zeit politischer Instabilität in Ungarn, während der er in Wien lebte, kehrte Auer nach Budapest zurück. 1921 wurde er zum Rechtsberater der französischen Gesandtschaft in Ungarn ernannt. In dieser Funktion beteiligte er sich in den 1920er und 1930er Jahren "diskret an der Entwicklung der offiziellen französisch-ungarischen Beziehungen".
In der Zwischenkriegszeit beteiligte sich Pál Auer an den Aktivitäten der Paneuropa-Union unter dem Vorsitz von Graf Richard Coudenhove-Kalergi. Ab 1930 war er Präsident der ungarischen Sektion der Paneuropa-Union. Wie Elemér Hantos befürwortete auch Auer eine Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit zwischen den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns. Deshalb organisierte er im Februar 1932 eine Donaukonferenz in Budapest.
Im Anschluss an diese Konferenz leitete er das Komitee für die wirtschaftliche Annäherung der Donauländer. Ein Donaubund war ihm besonders wichtig, um den Anschluss Österreichs durch Nazi-Deutschland zu verhindern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Pál Auer Mitglied des ungarischen Parlaments und Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten. Im März 1946 wurde Auer zum Leiter der ungarischen Gesandtschaft in Paris ernannt. Nach der kommunistischen Machtergreifung 1947 war Auer "gezwungen, ins Exil zu gehen" und blieb in Paris, wo er weiterhin als "Vermittler zwischen Mitteleuropa und Frankreich" fungierte. Auer engagierte sich auch in der von Winston Churchill initiierten Europäischen Bewegung. Bis zu seinem Tod verteidigte er das Konzept einer "Donaukonföderation".
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten.
Aristide Briand (1862–1932), französischer Anwalt, Journalist, Politiker und Friedensnobelpreisträger.
Nach seinem Jurastudium an der Universität Paris begann Aristide Briand seine berufliche Laufbahn als Anwalt und Journalist. 1902 wurde Briand Mitglied der Abgeordnetenkammer des französischen Parlaments. Nachdem er 1906 das Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat erfolgreich verteidigt hatte, diente er als Minister in verschiedenen Regierungen und wurde vor und während des Ersten Weltkriegs mehrfach zum Premierminister ernannt.
Nach dem Krieg wurde Aristide Briand Frankreichs ständiger Delegierter beim Völkerbund. Von 1921 bis 1922 war Briand Premierminister und für das Ressort Auswärtige Angelegenheiten zuständig. Ab 1925 verließ er das französische Außenministerium erst 1932, kurz vor seinem Tod, aus gesundheitlichen Gründen. Als französischer Außenminister war Aristide Briand der Architekt der im Oktober 1925 unterzeichneten Locarno-Abkommen, die zur Entspannung der deutsch-französischen Beziehungen und zur Stabilisierung der politischen Nachkriegsordnung Europas beitrugen. Aus diesem Grund wurde Briand im Dezember 1926 gemeinsam mit seinem deutschen Amtskollegen Gustav Stresemann der Friedensnobelpreis verliehen. Nach der Unterzeichnung des Briand-Kellog-Pakts im August 1928, der „den Krieg ächtete“, sah er die wirtschaftliche und politische Vereinigung Europas als nächsten Schritt in seinem System der kollektiven Sicherheit in Europa. In diesem Sinne unterstützte er „pro-europäische“ Organisationen wie die Pan Europa Union des Grafen Richard Coudenhove-Kalergi und das Französische Komitee des Europäischen Zollverein.
Im September 1929 verkündete Aristide Briand in einer Rede vor der Generalversammlung des Völkerbundes seinen Wunsch, eine "Art föderales Band" zwischen den europäischen Völkern zu schaffen. Elemér Hantos war überzeugt, dass „aus Briands Reden die Idee der wirtschaftlichen Einheit Europas und nicht die eines politischen Paneuropas hervorging“. Deshalb war Hantos enttäuscht, als Briand in seinem im Mai 1930 vorgelegten Memorandum den Vorrang der Politik vor der Wirtschaft bekräftigte.
Nach der Ankündigung des Projekts einer deutsch-österreichischen Zollunion im März 1931, das einen Wendepunkt in der deutschen Außenpolitik markierte, legte Aristide Briand der Studienkommission für die Europäische Union des Völkerbundes im September 1931 das Memorandum von Elemér Hantos über die wirtschaftliche Neuordnung Mitteleuropas vor.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Richard Coudenhove-Kalergi (1894–1972), österreichischer Philosoph und Politiker.
Nach seiner Promotion in Philosophie an der Universität Wien im Jahr 1917 entwickelte Richard Coudenhove-Kalergi seine paneuropäische Idee in mehreren Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln. In seinem 1923 in Wien erschienenen Programmbuch Pan-Europa forderte Coudenhove-Kalergi die politische und wirtschaftliche Vereinigung der europäischen Staaten mit Ausnahme der Türkei, des Britischen Empires und Sowjetrusslands. Im wirtschaftlichen Teil seines Programms befürwortete er die Schaffung eines paneuropäischen Wirtschaftsraums durch die Beseitigung aller Wirtschafts-, Zoll- und Transportschranken zwischen den europäischen Staaten. Coudenhove-Kalergi war der Ansicht, dass die wirtschaftliche Vereinigung Europas nur schrittweise erreicht werden könne. In diesem Sinne sah er als ersten Schritt hin zu einer paneuropäischen Wirtschaftsunion die Bildung von Wirtschafts-, Zoll- und Währungsallianzen zwischen mehreren Ländern, wie etwa den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns, die er in seinem Programmbuch ausdrücklich erwähnte.
Um seine paneuropäische Idee zu fördern, gründete Richard Coudenhove-Kalergi in Wien die Paneuropa Union, die in ganz Europa nationale und lokale Sektionen hatte, zahlreiche Artikel veröffentlichte, mit politischen Führern verhandelte und regelmäßig paneuropäische Konferenzen und Kongresse organisierte. Nach der Annexion Österreichs durch Nazideutschland ging Coudenhove-Kalergi ins Exil nach Paris und später nach New York. Nach dem Zweiten Weltkrieg inspirierte er Winston Churchills berühmte „Zürcher Rede“ und beteiligte sich an der Europäischen Bewegung. Für sein über 25 Jahre andauerndes Engagement für die politische und wirtschaftliche Einigung Europas erhielt Coudenhove-Kalergi 1950 den ersten internationalen Karlspreis der Stadt Aachen.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Georg Gothein (1857–1940), deutscher Ingenieur, Politiker und Ökonom.
Nach seinem Studium an der Universität Breslau (heute Wrocław) und der Preußischen Bergakademie in Berlin begann Georg Gothein seine Karriere als Bergbeamter in Schlesien und arbeitete später auch als Justiziar der Industrie- und Handelskammer in Breslau. Dank „seiner hervorragenden Fähigkeiten, die er stets im Geiste des Liberalismus und des Freihandels einsetzte“, zog Gothein 1893 in das Preußische Abgeordnetenhaus und 1901 in die Deutsche Reichsversammlung ein. Nach dem Ersten Weltkrieg war er nicht nur bis 1924 Mitglied der Deutschen Nationalversammlung, sondern 1919 auch kurzzeitig Minister ohne Geschäftsbereich und Reichsschatzminister, bevor er nach der Ratifizierung des Versailler Vertrags aus der deutschen Regierung ausschied.
Als Verfechter des Freihandels beteiligte sich Georg Gothein an den Aktivitäten des Deutschen Handelsvertragsverein und der im November 1921 gegründeten Deutschen Freihandelsliga und war von 1926 bis 1930 Vorsitzender der "Deutschen Gruppe“ der Mitteleuropäischen Wirtschaftstagung. In dieser Funktion kritisierte er das mitteleuropäische Projekt von Elemér Hantos, der eine wirtschaftliche Annäherung zwischen den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns befürwortete, weil Deutschland zunächst davon ausgeschlossen war. Gothein war ein entschiedener Befürworter des wirtschaftlichen Anschlusses Österreichs an Deutschland, den er als den einzig möglichen Weg zur Verwirklichung eines „Großmitteleuropas“ oder eines wirtschaftlichen Paneuropas betrachtete. Hantos war gegen die wirtschaftliche und politische Anbindung Österreichs an Deutschland, weil er die wirtschaftliche und politische Vorherrschaft Deutschlands fürchtete und wollte, dass die Nachfolgestaaten als gleichberechtigtere Partner verhandeln konnten.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Gusztáv Gratz (1875–1944), ungarischer Journalist, Ökonom, Politiker und Diplomat.
Nach seiner Promotion in Staatswissenschaften an der Universität Kolozsvár/Klausenburg (heute Cluj-Napoca) im Jahr 1898 begann Gusztáv Gratz seine Karriere als Journalist. Später, im Jahr 1906, wurde er als Vertreter der Siebenbürger Sachsen Mitglied des ungarischen Parlaments.
1912 übernahm Gratz die Position des Geschäftsführers des Ungarischen Verbandes der Fabrikindustriellen. Während des Ersten Weltkrieges engagierte er sich besonders in der mitteleuropäischen Bewegung, die die Idee einer wirtschaftlichen Annäherung zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn propagierte. Er versuchte eine Formel zu finden, „die der ungarischen Industrie (innerhalb des deutsch-österreichisch-ungarischen Wirtschaftsbündnisses) einen gewissen Schutz gewährt hätte". 1917 wurde er zum Leiter der Außenhandelsabteilung des gemeinsamen Außenministeriums Österreich-Ungarns in Wien ernannt. Nach einem Regierungswechsel in Ungarn war er kurzzeitig Finanzminister, bevor er ins Außenministerium zurückkehrte. Von 1917 bis 1918 nahm er nicht nur an den Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland über eine mitteleuropäische Wirtschaftsunion teil, sondern auch an den Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk und Bukarest.
Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns und der politischen Instabilität in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg wurde Gusztáv Gratz zum ungarischen Botschafter in Wien ernannt, bevor er im Januar 1921 ungarischer Außenminister wurde. In dieser Funktion plante Gratz eine wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns, um die Region innerhalb der neuen internationalen Ordnung zu stabilisieren. Nachdem er die beiden gescheiterten Restaurationsversuche des ehemaligen ungarischen Königs Karl unterstützt hatte, wurde Gratz aus der ungarischen Politik ausgeschlossen. 1926 zog er trotzdemals Vertreter der deutschen Minderheit in Ungarn erneut ins ungarische Parlament ein.
Ab 1925 war Gusztáv Gratz Herausgeber des Ungarischen Wirtschaftsjahrbuchs, das einen Überblick über die wirtschaftliche Lage Ungarns nach dem Zerfall des Wirtschaftsraums Österreich-Ungarn bot. Wie Elemér Hantos befürwortete Gratz eine wirtschaftliche Annäherung zwischen den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns als ersten Schritt hin zu einer Europäischen Wirtschafts- und Zollunion und beteiligte sich an den Aktivitäten der Mitteleuropäischen Wirtschaftstagung und der Paneuropa Union. Ab 1930 war er Präsident des von Elemér Hantos gegründeten Mitteleuropa-Instituts in Budapest.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Milan Hodža (1878–1944), slowakischer Journalist, Historiker und Politiker.
Nach seinem Jurastudium in Kolozsvár/Klausenburg (heute Cluj-Napoca) und Budapest begann Milan Hodža seine berufliche Laufbahn als Journalist. 1905 wurde er als Vertreter der Slowaken und der Serben des Banats zum Abgeordneten des ungarischen Parlaments in Budapest gewählt. Während seiner Amtszeit setzte sich Hodža für die Zusammenarbeit zwischen den Slowaken und den Tschechen ein und gründete den „Nationalitätenklub“, der slowakische, serbische und rumänische Abgeordnete versammelte. Zu dieser Zeit war er auch Mitglied des „Belvedere-Kreises“ des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und arbeitete an der Umwandlung der Habsburgermonarchie in eine Föderation von Nationalstaaten. Während des Ersten Weltkriegs promovierte er an der Universität Wien in Philosophie.
Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns war Milan Hodža an der Schaffung des neuen tschechoslowakischen Staates beteiligt und wurde Vertreter der tschechoslowakischen Regierung in Budapest. Ab 1920 war Hodža für die Agrarpartei Abgeordneter der Abgeordnetenkammer des tschechoslowakischen Parlaments. 1921 wurde er außerdem zum Professor für Geschichte an der Universität Bratislava ernannt. In der Zwischenkriegszeit war er mehrfach Minister: Landwirtschaftsminister von 1922-1926 und von 1932 bis 1935 sowie Bildungsminister von 1926 bis 1929.
Als Landwirtschaftsminister wollte Milan Hodža die mitteleuropäische Agrarkrise durch die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns lösen. Nach Adolf Hitlers Machtergreifung war Hodža ein starker Befürworter einer wirtschaftlichen Annäherung zwischen den Donaustaaten im Einklang mit den Ideen von Elemér Hantos. Als Präsident der tschechoslowakischen Regierung ab November 1935 mit dem Geschäftsbereich "Auswärtige Angelegenheiten" bemühte er sich vergeblich um eine Einigung mit den anderen Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns.
Nach dem Münchner Abkommen im September 1938 wurde seine Regierung zum Rücktritt gezwungen und Milan Hodža ging ins Exil, zunächst in die Schweiz, später nach Frankreich und Großbritannien und schließlich in die USA, wo er 1942 sein berühmtes Buch "Schicksal Donaraum: Erinnerungen“ veröffentlichte.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Rudolf Hotowetz (1865–1945), tschechischer Ökonom und Politiker.
Wenige Jahre nach Abschluss seines Jurastudiums an der Tschechischen Universität in Prag begann Rudolf Hotowetz seine Tätigkeit bei der Prager Handelskammer, „wo er allmählich bis zum Generalsekretär aufstieg“ und viel zu deren ausgezeichnetem Ruf beitrug. Im Jahr 1917 wurde er nach jahrelanger Vorarbeit zum Präsidenten der neugegründeten Allgemeinen Rentenanstalt ernannt.
Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns und der Gründung der Tschechoslowakei wurde Rudolf Hotowetz Präsident des Außenhandelsamtes und später Handelsminister. Hotowetz musste „mit ernsthaften Schwierigkeiten fertig werden, die sich aus der Trennung der Tschechoslowakei von der früheren Wirtschaftseinheit ergaben“. Zusammen mit seinem Kollegen Václav Schuster war er für „die Festlegung der ersten Linien der [tschechoslowakischen] Handelspolitik und den Abschluss der ersten und wichtigsten Handelsverträge“ des neuen tschechoslowakischen Staates verantwortlich. Im September 1921 trat Hotowetz als Handelsminister zurück, um seinen Widerstand gegen die von der Nationalversammlung beschlossenen neuen Zölle zum Ausdruck zu bringen.
Von da an befürwortete Rudolf Hotowetz eine wirtschaftliche Annäherung zwischen der Tschechoslowakei und den anderen Nachfolgestaaten. Darüber hinaus förderte er auch die wirtschaftliche Vereinigung Europas. Im Gegensatz zu Richard Coudenhove-Kalergi, dem Führer der Paneuropa-Bewegung, war Hotowetz der Ansicht, dass Sowjetrussland in den europäischen Wirtschaftsraum einbezogen werden sollte. Zusammen mit dem österreichischen Geschäftsmann Julius Meinl und dem ungarischen Ökonomen Elemér Hantos war Hotowetz einer der Initiatoren der ersten Mitteleuropäischen Wirtschaftstagung in Wien im September 1925. Er war auch Vizepräsident des Tschechoslowakischen Komitees für mitteleuropäische wirtschaftliche Zusammenarbeit und Präsident der tschechoslowakischen Sektion des Europäischen Zollvereins.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten.
Walter Lippmann (1889–1974), amerikanischer Journalist, Philosoph und Pulitzer-preisträger.
Nach seinem Studium an der Harvard University begann Walter Lippmann eine journalistische Karriere. Im November 1914 gehörte er zu den Gründungsherausgebern der "New Republic", in der er sich für ein Ende des amerikanischen Isolationismus einsetzte. Am Ende des Ersten Weltkriegs wurde Lippmann "gebeten, der "Inquiry" beizutreten, einer nichtstaatlichen und weitgehend geheimen Organisation, die gegründet worden war, [...] um die amerikanischen Friedensbedingungen auszuarbeiten. Als Generalsekretär wirkte er an der Ausarbeitung von Woodrow Wilsons berühmtem Vierzehn-Punkte-Programm mit. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm Lippmann als Mitglied der amerikanischen Delegation an der Pariser Friedenskonferenz teil. Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten con Amerika lehnte er die Ratifizierung des Versailler Vertrags ab, der für ihn, "wie für viele andere auch", wie etwa den britischen Ökonomen John Maynard Keynes, den er in Paris kennengelernt hatte, "eine ernüchternde Erfahrung" war.
In der Zwischenkriegszeit entwickelte sich Walter Lippmann zu einem der einflussreichsten Journalisten und Kolumnisten und schrieb für die New Yorker Zeitungen „World“ und „Herald Tribune“. Darüber hinaus war er ein renommierter "öffentlicherPhilosoph". Nach der Internationalen Wirtschaftskonferenz, die im Juni und Juli 1933 in London stattfand, begann Lippmann, sich mit dem Liberalismus zu beschäftigen. Seine Forschungen mündeten 1937 in der Veröffentlichung von „Die Gesellschaft guter Menschen“, das den Grundstein für das berühmte „Lippmann-Kolloquium“ legte, das die Erneuerung des liberalen Denkens markierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte er den Marshallplan zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Julius Meinl II. (1869–1944), österreichischer Geschäftsmann.
Nach seinem Studium an der Wiener Handelsakademie und einem kurzen Aufenthalt in London begann Julius Meinl, im Nahrungsmittelunternehmen seines Vaters zu arbeiten. Nach der Pensionierung seines Vaters, übernahm Meinl 1913 das Unternehmen, das unter seiner Führung trotz der vielen wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten seiner Zeit weiter expandierte.
Während des Ersten Weltkriegs gründete Meinl zusammen mit dem österreichischen Industriellen Max Friedmann die Österreichische Politische Gesellschaft. Die Österreichische Politische Gesellschaft versammelte Geschäftsleute, Professoren und Politiker, um politische und wirtschaftliche Fragen zu diskutieren. Mit den beiden österreichischen Juristen und Politikern Heinrich Lammasch und Josef Redlich nahm er 1917–1918 an Friedensgesprächen mit Vertretern der Vereinigten Staaten von Amerika teil.
Nach dem Ersten Weltkrieg litt Julius Meinls Unternehmen unter den Folgen des Zerfalls des Wirtschaftsraums Österreich-Ungarn. Deshalb setzte sich Meinl für die Wiederherstellung des Freihandels innerhalb der Nachfolgestaaten ein. 1924 gründete Meinl den Österreichischen Freihandebund, um gegen die von der österreichischen Regierung geplanten neuen Zollerhöhungen zu kämpfen. In dieser Funktion lud Meinl andere Freihandelsbefürworter wie Václav Schuster, Elemér Hantos und Rudolf Hotowetz zu Konferenzen ein. Gemeinsam initiierten sie im September 1925 die erste Mitteleuropäische Wirtschaftstagung in Wien mit der Absicht, auf eine wirtschaftliche Annäherung zwischen den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns hinzuarbeiten.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Ludwig Mises (1881–1973), österreichischer Ökonom.
Nach der Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften an der Universität Wien, wo er auch Volkswirtschaftslehre studierte, trat Ludwig Mieses 1909 in den Dienst der Wiener Handelskammer. Vor dem Ersten Weltkrieg habilitierte sich Mises im Fach Volkswirtschaftslehre und begann an der Universität Wien zu lehren, wo er 1918 Professor wurde.
Im September 1925 nahm Ludwig Mises an der ersten Mitteleuropäischen Wirtschaftstagung teil. Ab 1928 war er zudem Mitglied des Internationalen Komitees des Europäischen Zollverein. Nach der Veröffentlichung eines Buches von Elemér Hantos, in dem er die wirtschaftliche Vereinigung der Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns als ersten Schritt hin zu einer europäischen Zoll- und Wirtschaftsunion darstellte, trat Mises im März 1929 zurück, da er es für unmöglich hielt, in Organisationen mitzuwirken, die sich dem wirtschaftlichen Anschluss Österreichs an Deutschland widersetzten. Nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland nahm er jedoch an den von Graf Richard Coudenhove-Kalergi organisierten Paneuropäischen Wirtschaftskonferenzen teil.
1934 wurde Ludwig Mises von William Rappard eingeladen, eine Gastprofessur am Hochschyulinstitut für internationale Studien (Graduate Institute of International Studies) in Genf zu übernehmen. 1940 emigrierte er nach New York, wo er während und nach dem Zweiten Weltkrieg seine wissenschaftliche Arbeit fortsetzte. Ludwig Mises galt als führender Vertreter des Wirtschaftsliberalismus.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Jean Monnet (1880–1979), französischer Geschäftsmann, internationaler Beamter und Politiker.
Jean Monnet verließ das Gymnasium ohne Abschluss, um im Cognac-Familienunternehmen zu arbeiten und bereiste dafür die Welt. Während des Ersten Weltkriegs beteiligte er sich an der Organisation der Kriegswirtschaft, insbesondere an der Koordinierung der französisch-britischen Versorgungsbemühungen in London.
Nach dem Krieg wurde Monnet zum stellvertretenden Generalsekretär des Völkerbundes ernannt. In dieser Funktion organisierte er die Internationale Finanzkonferenz, die im September 1920 in Brüssel stattfand. Er nahm auch an mehreren Missionen des Völkerbundes teil, bevor er im Dezember 1922 zurücktrat, um sich der Reorganisation des angeschlagenen Cognac-Familienunternehmens zu widmen. Ab 1926 begann Monnet eine Karriere als internationaler Bankier.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs kehrte Monnet nach Frankreich zurück und beteiligte sich an der Vorbereitung und Koordinierung der französisch-britischen und transatlantischen Rüstungsanstrengungen. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris im Juni 1940 unterstützte er das Projekt der französisch-britischen Union. Nach dem Fall Frankreichs wurde Monnet von der britischen Regierung in die Vereinigten Staaten entsandt, um über den Kauf von Kriegsgütern zu verhandeln und die Kriegsanstrengungen zu koordinieren.
Nach der alliierten Intervention in Französisch-Nordafrika im November 1942 nahm Monnet an den Verhandlungen teil, die zur Gründung des französischen Komitees der Nationalen Befreiung führten. 1943 begann er in Algier über die europäische Einigung nach dem Krieg nachzudenken. Als französischer Planungskommissar leitete Jean Monnet nach dem Zweiten Weltkrieg den wirtschaftlichen Wiederaufbau Frankreichs. Er arbeitete im Verborgenen an der wirtschaftlichen Einigung Europas und verfasste die berühmte „Schuman-Erklärung“, die am 9. Mai 1950 vorgelegt wurde und als Ausgangspunkt des sogenannten "europäischen Aufbaus gilt.
Während der Verhandlungen zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) schlug Jean Monnet dem französischen Ratspräsidenten René Pleven die Gründung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) vor. Nach Inkrafttreten des Pariser Vertrags im Juli 1952 wurde Monnet der erste Präsident der Hohen Behörde der EGKS. Der Vertrag zur Gründung der EVG wurde im Mai 1952 in Paris von den Regierungen der sechs Gründungsmitglieder der EGKS unterzeichnet. Monnets Initiative scheiterte jedoch im August 1954 an der Ablehnung der Ratifizierung durch die französische Nationalversammlung.
Nach seinem Rücktritt gründete Monnet sein Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa, um die Voraussetzungen für eine stärkere europäische Wirtschaftsintegration zu schaffen. Mit seinem Komitee setzte er sich während des europäischen „Aufschwungs“, der ab 1955 von der niederländischen und belgischen Regierung angeführt wurde, für eine Atomenergiegemeinschaft und einen Binnenmarkt ein. Dieser „Aufschwung“ führte im März 1957 zur Unterzeichnung der Römischen Verträge, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft gegründet wurden.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
William Rappard (1883–1958), Schweizer Historiker, Ökonom und internationaler Beamter.
Nach seinem Doktorat in Rechtswissenschaften an der Universität Genf begann er seine berufliche Laufbahn 1909 als Sekretär bei der Internationalen Arbeitsorganisation mit Sitz in Basel. Nach einigen Jahren als Dozent wurde er 1913 zum Professor an der Universität Genf ernannt, wo er von 1926 bis 1928 und von 1936 bis 1938 auch das Amt des Rektors innehatte. 1928 gründete er in Genf das Hochschulinstitut für internationale Studien, das er bis 1955 leitete. Von 1920 bis 1925 war Rappard auch für den Völkerbund tätig.
In den 1930er Jahren verurteilte William Rappard die Bedrohung des Friedens durch politischen und wirtschaftlichen Nationalismus und setzte sich für ein vereintes Europa ein. Als Direktor des Hochschulinstituts lud er Elemér Hantos 1930 ein, eine Reihe von Konferenzen über Mitteleuropa zu halten.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten. Die Biografie auf Wikipedia finden Sie hier.
Václav Schuster (1871–1944), tschechischer Ökonom, Politiker, Diplomat und Bankier.
Nach Abschluss seiner Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften an der Tschechischen Universität in Prag trat Václav Schuster in den Dienst der Handelskammer in České Budějovice ein, bevor er seine Tätigkeit bei der Handelskammer in Prag aufnahm, wo er 1917 die Nachfolge von Rudolf Hotowetz als Generalsekretär antrat.
Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns und der Gründung des tschechoslowakischen Staates wurde Václav Schuster Staatssekretär im Handelsministerium und nahm später als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister an den Handelsverhandlungen mit den Großmächten und den anderen Nachfolgestaaten teil. In dieser Funktion war Schuster maßgeblich an der Gestaltung der tschechoslowakischen Handelspolitik beteiligt. Für einen Journalisten der deutschen Zeitung Prager Presse, die von der tschechoslowakischen Regierung unterstützt wurde, „wird man sich an ihn wegen seiner klarsichtigen und mutigen Opposition gegen den sofort aufkommenden Radikalismus in der Handelspolitik erinnern, selbst auf die Gefahr hin, dass sein [tschechischer] Patriotismus in Frage gestellt wurde“. Ab 1922 war Schuster Präsident einer tschechischen Bank und saß gleichzeitig in den Vorständen zahlreicher privater Unternehmen, öffentlicher Institutionen und verschiedener Verbände.
„Mit scharfem Blick“ erkannte Václav Schuster „früher als alle anderen die praktische Bedeutung der [wirtschaftlichen] Einigungsbewegungen […] als dieses Ziel noch eine nebulöse Utopie zu sein schien“.
Wie Elemér Hantos befürwortete Schuster eine wirtschaftliche Annäherung zwischen den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns als ersten Schritt zur wirtschaftlichen Vereinigung des gesamten europäischen Kontinents. Er war Präsident der tschechoslowakischen Sektion der Paneuropa Union und beteiligte sich auch an den Aktivitäten des Tschechoslowakischen Komitees für mitteleuropäische Wirtschaftskooperation, der tschechoslowakischen Sektion des Europäischen Zollverein und des Mitteleuropa-Instituts in Brno.
Klicken Sie hier, um Angaben zum Autor, zu den Quellen (auf Englisch) und zum Bildnachweis zu erhalten.